 Adventskalender 2025 T-18: Alan Moore – Jerusalem (zum 1. oder 2. Mal)
Adventskalender 2025 T-18: Alan Moore – Jerusalem (zum 1. oder 2. Mal)
von Oliver L. am 6. Dezember 2025 11 Kommentare
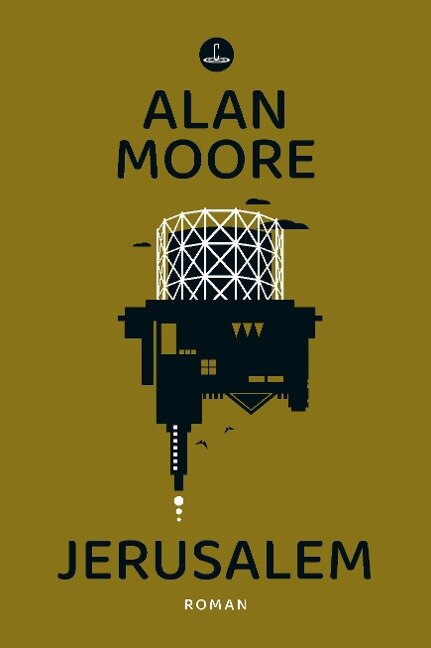
- Alan Moore
Jerusalem
Übersetzung Hannes Riffel und Andreas Fliedner
Berlin, Memoranda Verlag, 2024, 1443 S. Hardcover
ISBN 9783910914209 / € 78,00
Bevor wir an dieser Stelle in die Pötte kommen, muss ich wohl die Überschrift erklären. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe das Buch schon vor einigen Jahren in der englischen Version in Hermkes Romanboutique gesehen. Da ich mich wohl mit Fug und Recht als Fan des Autoren Alan Moore bezeichnen kann, habe ich natürlich über einen Kauf nachgedacht. Letzten Endes bin ich aber immer wieder davor zurückgeschreckt. Obwohl mir Moore auf Englisch durchaus geläufig ist und ich nie das Gefühl hatte, dass er es seinen Lesern unnötig schwer macht. Aber ein Roman der schon auf den ersten Blick sehr komplex wirkt … Das habe ich mich letzten Endes nicht getraut. Als ich das Buch dann angefangen habe, in der vorliegenden Version von Carcosa auf Deutsch, hat sich diese Entscheidung durchaus als richtig erwiesen. Im Endeffekt habe ich das gesamte Jahr an „Jerusalem“ gelesen. Und schon sehr früh kam ich zum Schluss, dass es mit einer Betrachtung nicht getan sein wird. Einen Umstand, den ich gelegentlich auch mit Horst Illmer besprochen habe. In meiner naiven Vorstellungswelt hätte es am Ende mindestens drei Besprechungen auf comicdealer.de gegeben. Von Horst, Gerd und mir. Gerd dürfte vom Tisch sein. Mein letzter Stand ist, dass er dieses Mammutwerk abgebrochen hat. Als ich Horst vor ca. 4 Wochen (Stand: 18. Oktober) zuletzt gesehen habe, war er noch mit dem Kapitel „Neben der Spur“ beschäftigt. Ich weiß also zur Stunde nicht, ob er das Buch bereits abgeschlossen und seine Gedanken dazu schon zu Papier gebracht hat. Aus meiner Perspektive kann ich also unmöglich sagen, ob dies nun das erste oder zweite Mal ist, dass ihr an dieser Stelle etwas über „Jerusalem“ lesen werdet.
In der Regel habe ich den Anspruch, dass ich für Gerd, Burn und Co. nur Texte verfasse, die dem Verkauf des besprochenen Produkts dienlich sein soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesem Anspruch heute gerecht werden kann. Alan Moore ist hier oft genug besprochen worden. Er kam in diversen „Podcast“-Beiträgen zur Sprache und es gibt mindestens zwei Beiträge zu „Watchmen“, einen zweiteiligen Artikel zu „Miracleman“ und einen zu seiner Lovecraft-Pastiche „Neonomicon“. Und das sind nur die Beiträge, die mir ad hoc einfallen. „Jerusalem“ stellt mich vor das eine oder andere Problem. Angefangen damit, dass ich gar nicht weiß, wem ich dieses Buch empfehlen könnte. Tatsächlich habe ich heute bereits einen kleinen Vorsprung in diese Richtung gewagt. Ein Angehöriger einer Bewohnerin an meiner Arbeitsstelle war Lehrer für Geschichte mit einer Spezialisierung auf amerikanische und englische Geschichte. Dazu später mehr. Das andere große Problem ist, dass ich „Jerusalem“ wohl abgebrochen hätte, wenn es nicht von Alan Moore geschrieben worden wäre. Mir fällt nicht mal eine Handvoll anderer Autoren ein, bei denen ich dieses Werk auch bis zum Ende durchgehalten hätte. Und davon ist einer seit vielen Jahren tot: Lovecraft, Jim Starlin (eher als Comicautor bekannt) und Thomas Ligotti (von dem es wohl noch ein gutes Stück wirrer gewesen wäre).
Stellen wir uns zunächst die Frage, was „Jerusalem“ eigentlich sein soll. Da muss zuerst festgestellt werden, dass es nicht um die Hauptstadt Israels geht. Der Titel leitet sich von William Blakes eigentlich titellosem Gedicht ab, welches er seinem „Milton: A Poem in Two Books“ vorangestellt hat. Da wir hier uns hier unter Nerds befinden, dürfte Blake vielen von euch schon untergekommen sein. Eine abgewandelte Form seines Gedichts „The Tyger“ wurde von J. M. DeMatteis für „Spider-Man: Kraven’s Last Hunt“ verwendet und der US-Titel einer Folge der 2. Staffel („Fearful Symmetry““ von „The X-Files“ bezieht sich ebenfalls auf diese Verse. Williams Blakes Gemälde „Ghost of a Flea“ war das Cover von Bruce Dickinsons (Iron Maiden) 98er Album „The Chemical Wedding“ (das beste Album, dass Iron Maiden nicht gemacht haben). Und auch Alan Moore hat sich zuvor schon auf Blake bezogen. Eben jenes Bild hat William Gulls Geist am Ende von „From Hell“ auf seiner Reise durch die Zeit ebenfalls kurz gesehen. Vor gut 12 Jahren habe ich mir den (noch immer lieferbaren) Band Zwischen Feuer und Feuer, dessen Untertitel Gerd scherzhaft als „pötische Werke“ bezeichnete (vielleicht erinnert er sich) gegönnt. Das betroffene Gedicht könnt ihr bei Interesse ab Seite 202 finden.
Neben der Blake-Konnotation ist „Jerusalem“ auch ein autobiographisches und lokalhistorisches Werk. Eben letzteres hat mich dazu motiviert, es o. g. Geschichtslehrer a. d. anzuempfehlen. Alan Moore hat sich, in Form der Künstlerin Alma Warren, selbst in die Geschichte integriert. Deren Bruder Mick dürfte demnach ein Analog zu Moores Bruder Mike sein. Seine Frau, die Künstlerin Melinda Gebbie, Alan Moores Frau, taucht ebenfalls am Rande auf und ist mit Alma befreundet. Man muss wohl davon ausgehen, dass der gesamte Clan aus Vernalls und Warrens Moores eigene Genealogie darstellt. In seiner Biographie kenne ich mich allerdings nicht gut genug aus, um das zu beurteilen. Schließlich und endlich geht es auch um die Geschichte seiner Heimatstadt Northhampton, besonders den als „The Buroughs“ bekannten Stadtteil. So treten auch allerlei historische Namen auf, die man mit dem Ort mehr oder weniger in Verbindung bringen kann. Hier an dieser Stelle auf alle einzugehen wäre müßig. Ich verweise deshalb auf den Beitrag von Udo Klotz in der „phantastisch!“ (Ausgabe 2/2025, Seite 32 ff.). Dort gibt es eine schöne Grafik, die viele der Verbindungen aufzeigt. Ich habe keinerlei historische Fakten überprüft. Das Buch hat mich so schon lange genug beschäftigt. Aber das führt zur einzigen, kleinen Verbindung zur Stadt Jerusalem. Einer Legende zufolge zog in altvorderer Zeit ein von Engeln (oder Angeln) beauftragter Mönch von Jerusalem los, um ein Steinkreuz in das Zentrum seines Landes zu bringen. Dieses Zentrum findet sich natürlich in Northampton, in den Buroughs. Ob das alles auf einer tatsächlichen Legende beruht … ich kann es nicht sagen. Das mag jemand anderes prüfen (Leslie Klinger?) …
Kommen wir nun zum Buch an sich bevor wir uns der Frage stellen, ob der Autor mit seinem Anliegen erfolgreich war. „Jerusalem“ ist in drei „Bücher“ aufgeteilt. Dabei ist nur das Mittlere geradlinig erzählt. Im ersten Buch springt Moore ständig zwischen den Zeiten und Figuren hin und her. Hier hilft ein gutes Gedächtnis (oder ein Notizblock). Zum Glück verfüge ich über ein gutes Gedächtnis. Ein Beispiel hierzu: Wir sehen ein Treffen zwischen der Prostituierten Marla und dem gescheiterten Dichter Benedict Perrit. Zunächst aus ihrer Perspektive, später aus Perrits Sicht. Und am Ende des dritten Buchs erhalten wir noch einen weiteren Blick auf diese Begegnung.
An anderen Stellen folgen solch unterschiedliche Perspektiven direkt aufeinander. Da wäre z. B. das Gespräch zwischen dem Schauspieler mit dem Spitznamen „Sir Francis Drake“ (ich habe erst im zweiten Buch kapiert, dass das Charlie Chaplin sein soll) und der älteren May Warren, welches wir zuerst aus der Perspektive des Schauspielers sehen und im anschließenden Kapitel dann aus Mays. Während des Gesprächs fährt die Figur des „Black Charley“ auf seinem skurrilen Fahrrad an der Szene vorbei. Das sehen wir dann wiederum im nächsten Kapitel aus dessen Sicht. Sehr wenig sehen wir von Alma und Mick Warren, die man wohl als Hauptakteure des Werks bezeichnen muss. Ob dies ein Problem ist mag jeder für sich selbst entscheiden. Alan Moore ist sich dessen aber durchaus bewusst. Im letzten Kapitel besucht Mick eine Kunstausstellung seiner Schwester. Er stellt fest, dass deren Werke wohl eine Geschichte erzählen, in denen die Hauptdarsteller nur am Rande vorkommen. Natürlich kann man auch die Stadt als eigentlichen Hauptcharakter identifizieren. In jedem Fall ist sich der Autor der Schwierigkeiten bewusst, die das Fehlen von eindeutigen Identifikationsfiguren mit sich bringt. Es hilft auch nicht unbedingt, dass er mit vielen verschiedenen Einflüssen und Erzählstilen experimentiert. Besonders nicht wenn man die Länge der Kapitel in Betracht zieht.
Das zweite „Buch“ unterscheidet sich deutlich vom Rest des Gesamtwerks. Wir folgen den Abenteuern des noch sehr jungen Mick Warren während einer Nahtoderfahrung. Mick kommt ins Obergeschoss (Himmel? Hölle? Totenreich?) und trifft auf ein Bande toter Kinder bzw. deren Geister. Da Mick eine wichtige Rolle zu erfüllen hat, müssen diese ihm dabei helfen, sich an seine Abenteuer im Obergeschoss (bzw. in „Menschenseele“) zu erinnern. Denn dies sei von äußerster Wichtigkeit. Dabei erleben sie allerlei Abenteuer während sie sich durch verschiedene Epochen graben, die sie zum Teil auch in die Welt der Lebenden bringt. Sie treffen z. B. Oliver Cromwell am Vorabend der Schlacht von Naseby. Erschwert wird das Unternehmen der Bande durch den Dämonen Asmodäus, der Mick zu einem Handel verleitet (den er aber scheinbar nie erfüllen muss). Das Obergeschoss ist dabei in mancher Hinsicht eine Kopie von Northampton und den Buroughs. Bis hin zu der Tatsache, dass dort einiges im Argen liegt. Wofür der Destruktor, die metaphysische Manifestation des Schornsteins einer Müllverbrennungsanlage (die wohl nicht mehr existiert wenn ich alles richtig verstanden habe), verantwortlich ist. Dieses Ende gilt es wohl abzuwenden. In Menschenseele erfahren wir auch, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wohl gleichzeitig existieren.
Im dritten „Buch“ springt Moore dann wieder zwischen allen möglichen Punkten hin und her. Dabei stellt er in manchen Kapiteln eine historische Figur aus der Geschichte Northamptons und eine der aktuellen Akteure direkt gegenüber. Auf diese Art begegnen wir Sir Isaac Newton in seiner Rolle als Leiter der staatlichen Münze. Northampton hatte wohl eine zentrale Rolle in der Entstehung einer britischen Währungsform (wieder: ich habe davon nichts geprüft). Mick und Alma kommen in diesem dritten Buch etwas öfter vor. Das ganze bezieht sich auf das erste Kapitel in welchem Mick, der sich nach einem Arbeitsunfall, wieder an einige seiner Erlebnisse in Menschenseele erinnern kann, Alma von diesen erzählt. Seine Schwester fasst dann das Vorhaben, diese Geschichte in Bilder zu fassen. Diese Kunstausstellung besuchen wir im letzten Kapitel.
Was will der Autor uns mit alldem nun sagen? Natürlich wäre da der autobiographische Anteil. Wie stark der auch immer sein mag. Aber im Zentrum dürfte wohl die Stadt, besonders jener als Buroughs bekannte Teil, stehen. Moore zeichnet die Entwicklung seiner Heimatstadt, an der ihm offensichtlich viel liegt, von einer einstmals wichtigen Ortschaft bis zu ihrem Verfall in den heutigen Zustand nach. Besonders die Buroughs sind dabei ein Problemviertel. Oder ein sozialer Brennpunkt wie man heute sagen würde. Moore stellt die Behauptung auf, dass jeder Einwohner dieses Viertels verschuldet sei. Schuld daran sei z. T. die Stadt selbst, die (bzw. deren Einwohner) als grundsätzlich aufsässig beschrieben werden und so das eine oder andere Mal in Konflikte mit König und Krone geriet. Was dann z. B. zur Auflösung der örtlichen Münze geführt habe. In moderneren Zeiten wird wohl auch Korruption eine Rolle gespielt haben, die etwaige Aufbaumaßnahmen für das Viertel zu Rohrkrepierern gemacht haben. Ein Stadtrat James Cockie soll sich dabei in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. In einem Kapitel ohne jedes Satzzeichen beteuert dieser seine Unschuld. Der Name scheint, wohl aufgrund des Vorwurfs, von Moore geändert worden zu sein. Zumindest konnte ich nichts über jenen Herrn Cockie finden. Vermutlich handelt es sich im richtigen Leben um den ehemaligen Amtsinhaber John Dicke.
Moore kann am Ende keine Lösung für seine Stadt anbieten. Was passieren muss wird passieren und es wird immer wieder passieren. So wird man auch immer wieder alten Bekannten begegnen und sein Leben immer wieder aufs Neue leben so wie wir es im zweiten „Buch“ in Menschenseele erleben. Ob das nun der Kern der Aussage des Buches ist, kann ich nicht abschließend feststellen. Aber es ist zumindest ein Teil dessen. Unterm Strich geht es ihm aber wohl um Northampton. Seiner Heimat, an der wohl, trotz aller Probleme, noch immer sein Herz hängt. Und obwohl er keine Lösung für diese Probleme aufzeigen kann, die Situation wohl sogar eher als ausweglos einschätzt, scheint er das alles nicht als per se negativ besetzt zu sehen. Der Eternalismus des sich stets wiederholenden Lebens (zu dem dann auch die Überschrift wieder passt) scheint ein Hoffnungsschimmer zu sein. Sofern ich mich nicht irre.
Das bringt mich (wie passend) zurück an den Anfang. Ich weiß nicht, wem ich dieses Buch empfehlen soll. Ich denke, dass es eine lohnende Lektüre sein kann, in der es viel zu entdecken gibt. Sofern man bereit ist, sich auf das alles einzulassen. Unser Lokalheld Christian Endres meinte mal zu mir, dass ich eher bereit bin, mich auf solche „Mindfucks von Moore, Neil Gaiman oder Grant Morrison“ mitnehmen zu lassen als er (wenn ich mich recht entsinne in Bezug auf „Sandman: Overture“). Dem mag durchaus so sein. „Jerusalem“ hat mich aber tatsächlich an meine Grenzen geführt. In einer Besprechung habe ich gelesen, dass, anders als bei seinen Comics (hier die Zeichner), niemand dabei war, der Moore einfängt, wenn er es übertreibt. Dem Eindruck schließe ich mich durchaus an. Da wäre die alles andere als lineare Erzählweise, die fast immer sehr langen Kapitel und das Spiel mit den verschiedenen Stilrichtungen (und die ganzen Einflüsse). Ein Kapitel ohne Satzzeichen (erstaunlich gut lesbar). Ein Kapitel in Form eines Theaterstücks (einer der Höhepunkte). Das Jugendbuch in der Mitte. Und dann ist da das oben schon angesprochene Kapitel „Neben der Spur“ in dem er James Joyces „Finnegans Wake“ nacheifert. Nahezu unlesbar aufgrund der … Phantasiesprache (aber immerhin, anders als bei Joyce, kein ganzes Buch in dieser Form). Und es trägt im Grunde nichts zum Rest des Buches bei. Wir sehen Joyces Tochter Lucia in Menschenseele (also dem Totenreich) als Patientin einer psychiatrischen Einrichtung wie sie durch die Zeiten wandelt. Dabei streift sie auch durch mehrere psychiatrische Kliniken (oder verschiedene Versionen derselben?) und trifft alle möglichen anderen Patienten. Darunter Schauspieler Patrick McGoohan („The Prisoner“). Sie reflektiert dabei über ihre Lebensgeschichte (z. T. wohl mit fiktiven Ereignissen angereichert) und das ganze endet damit, dass sie Sex mit dem Geist von Dusty Springfield hat.
Wie gesagt, ich denke, dass es sich durchaus um eine lohnende Lektüre handelt. Aber für wen? Man muss „Jerusalem“ wohl mehrfach lesen, um es in Gänze zu erfassen und wertzuschätzen. Allein, wer soll das tun? Ich habe fast ein Jahr daran gelesen. „Neben der Spur“ hat von dieser Zeit etwa einen Monat eingenommen. Ich wüsste nicht, wann ich mir diese Zeit noch mal nehmen könnte. Nicht in Anbetracht all der Bücher hier, die ich noch nicht gelesen habe, all derer die ich noch nicht gekauft habe, Arbeit im Schichtdienst, andere Interessen … Vielleicht mal, wenn Leslie Klinger tatsächlich eine kommentierte Version erstellt. Wer weiß.
Aber macht euch gerne alle selbst ein Bild. Immerhin ist es Alan Moore. Und Gerd freut sich über jedes verkaufte Exemplar.
And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?
[…]
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green & pleasant Land.
William Blake
- Alan Moore
Jerusalem
Übersetzung Hannes Riffel und Andreas Fliedner
Berlin, Memoranda Verlag, 2024, 1443 S. Hardcover
ISBN 9783910914209 / € 78,00
Bevor wir an dieser Stelle in die Pötte kommen, muss ich wohl die Überschrift erklären. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe das Buch schon vor einigen Jahren in der englischen Version in Hermkes Romanboutique gesehen. Da ich mich wohl mit Fug und Recht als Fan des Autoren Alan Moore bezeichnen kann,
- Kategorie: Adventskalender , Bücher , Fantasy , Oliver L's Bücherecke , Tipps
- 11 Kommentare


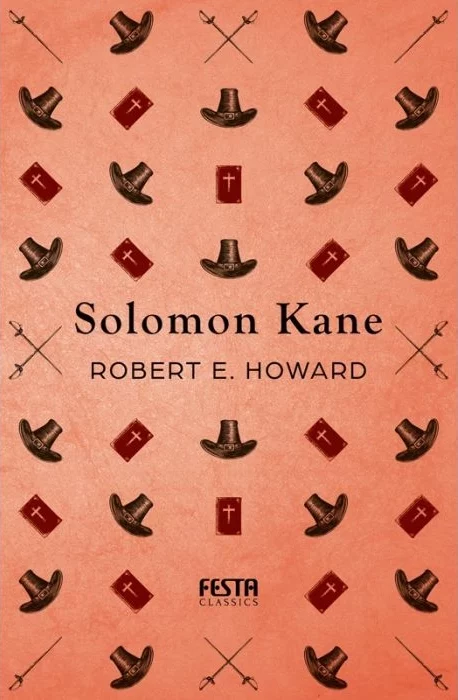


 Über Thomas Ligotti zu schreiben, stellt für mich stets eine gewisse Herausforderung dar. Zwar habe ich in einschlägigen Foren oder persönlichen Gesprächen schon das eine oder andere Wort über ihn verloren, aber an ein konzentriertes und ausführliches Statement habe ich mich bisher nicht gewagt. Zum Teil aus dem Gefühl heraus, „dem“ nicht gerecht zu werden. Aber auch aufgrund der Wirkung Ligottis Geschichten auf meine eigene Stimmung. Der 1953 in Detroit geborene Autor befleißigt sich einer fast schon poetischen Sprache, seine Geschichten sind zu einem guten Teil Spiegel seiner eigenen, dunkel gefärbten Weltsicht. Diese wiederum begründet sich in den psychischen Problemen Ligottis, bei dem eine bipolare Störung (manisch-depressive Störung) diagnostiziert wurde und der u. a. mit Agoraphobie („Platzangst“) und Anhedonie (die Unfähigkeit, Freude oder Lust zu empfinden) zu kämpfen hat. Das führt zu einer besonderen Atmosphäre in den Kurzgeschichten des zurückgezogen lebenden Schriftstellers, die im besten Sinne verstörend und dadurch vielfach erschreckender ist, als es die Blut- und Gewaltorgien einiger Kollegen Ligottis jemals sein werden. So ist er der einzige Autor, dessen Erzählungen ich bewusst nur in Maßen goutiere, da zu viel auf einen Schlag bei mir zu nicht zu verachtenden Stimmungseinbrüchen führt.
Über Thomas Ligotti zu schreiben, stellt für mich stets eine gewisse Herausforderung dar. Zwar habe ich in einschlägigen Foren oder persönlichen Gesprächen schon das eine oder andere Wort über ihn verloren, aber an ein konzentriertes und ausführliches Statement habe ich mich bisher nicht gewagt. Zum Teil aus dem Gefühl heraus, „dem“ nicht gerecht zu werden. Aber auch aufgrund der Wirkung Ligottis Geschichten auf meine eigene Stimmung. Der 1953 in Detroit geborene Autor befleißigt sich einer fast schon poetischen Sprache, seine Geschichten sind zu einem guten Teil Spiegel seiner eigenen, dunkel gefärbten Weltsicht. Diese wiederum begründet sich in den psychischen Problemen Ligottis, bei dem eine bipolare Störung (manisch-depressive Störung) diagnostiziert wurde und der u. a. mit Agoraphobie („Platzangst“) und Anhedonie (die Unfähigkeit, Freude oder Lust zu empfinden) zu kämpfen hat. Das führt zu einer besonderen Atmosphäre in den Kurzgeschichten des zurückgezogen lebenden Schriftstellers, die im besten Sinne verstörend und dadurch vielfach erschreckender ist, als es die Blut- und Gewaltorgien einiger Kollegen Ligottis jemals sein werden. So ist er der einzige Autor, dessen Erzählungen ich bewusst nur in Maßen goutiere, da zu viel auf einen Schlag bei mir zu nicht zu verachtenden Stimmungseinbrüchen führt.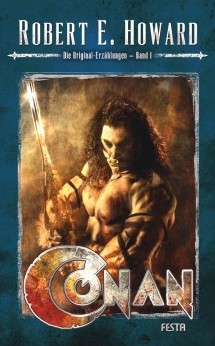



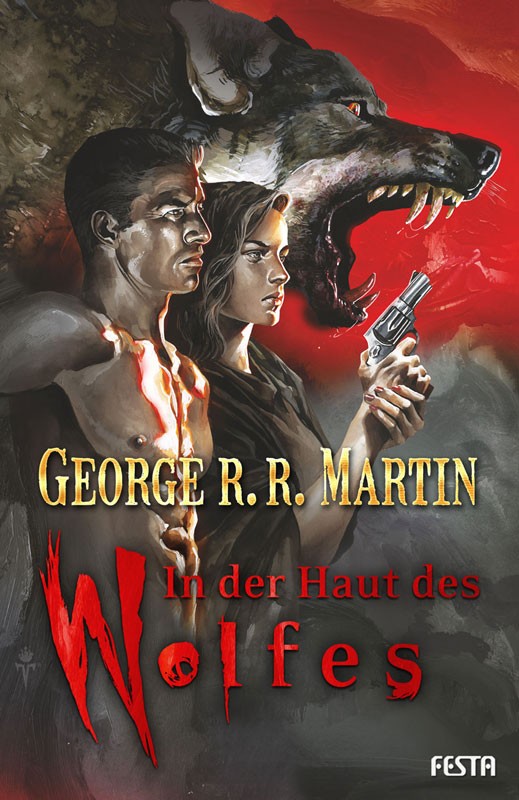


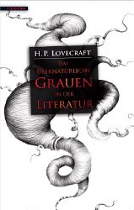 Sekundärliteratur, insbesondere zum Genre Phantastik, erscheint im ersten Moment uninteressant, es sei denn zu Recherchezwecken. Dennoch gibt es in diesem Bereich der Literatur immer wieder interessante Werke*. Einen dominanten Platz in diesem Feld nimmt hier einmal mehr J.R.R. Tolkien ein, der mit seinem „Der Herr der Ringe“ ein Werk vorgelegt hat, das seit nunmehr fast genau sechs Jahrzehnten die Fantasie von Millionen Lesern beflügelt und hat damit ein Werk von bleibender Kraft hinterlassen. Das hat nicht nur zu unzähligen Biographien über den Autor geführt. Auch seine Bücher selbst wurden auf die verschiedenste Weise bearbeitet, analysiert und besprochen.
Sekundärliteratur, insbesondere zum Genre Phantastik, erscheint im ersten Moment uninteressant, es sei denn zu Recherchezwecken. Dennoch gibt es in diesem Bereich der Literatur immer wieder interessante Werke*. Einen dominanten Platz in diesem Feld nimmt hier einmal mehr J.R.R. Tolkien ein, der mit seinem „Der Herr der Ringe“ ein Werk vorgelegt hat, das seit nunmehr fast genau sechs Jahrzehnten die Fantasie von Millionen Lesern beflügelt und hat damit ein Werk von bleibender Kraft hinterlassen. Das hat nicht nur zu unzähligen Biographien über den Autor geführt. Auch seine Bücher selbst wurden auf die verschiedenste Weise bearbeitet, analysiert und besprochen.
 Das Antiquariat als Bücherei
Das Antiquariat als Bücherei Der Laden und die Spiele
Der Laden und die Spiele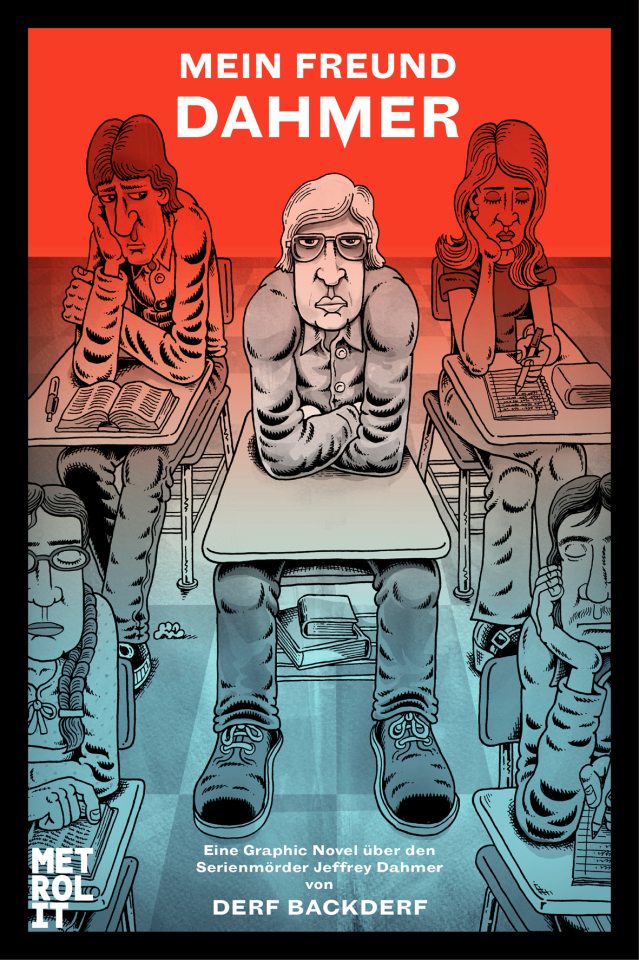
 Wer zu den Stammkunden von Hermkes Romanboutique gehört, wird die Wirkung dieses kleinen Buchladens jederzeit gerne bestätigen. Diese Wirkung beginnt bei den Räumlichkeiten, die ihren ganz eigenen Charme haben, und wird über die fleißigen Mitarbeiter (sic!) bis zu den regelmäßigen Besuchern des kleinen Ladens und den daraus entstehenden Grüppchen weitergegeben. Der Verfasser des folgenden Artikels heißt Dirk. Er lebt in Berlin und ist leider eher selten im Laden anzutreffen. Jedoch gehört er zu einem der oben angesprochenen Grüppchen und ist im Forum regelmäßig unter dem Namen Night Crawler aktiv. Ein passender Beitrag für einen Laden, der sich der phantastischen Literatur in all ihren Ausführungen verschrieben hat. Widmet er sich doch J. R. R. Tolkien, der in vielerlei Hinsicht als Vater der Fantasy zu sehen ist. Ein mehr als passender Beitrag also. Und ein schönes Beispiel für die Wirkung unserer kleinen Romanboutique. Vielen Dank an Dirk und alle Lesern viel Spaß bei der Lektüre des Artikels!
Wer zu den Stammkunden von Hermkes Romanboutique gehört, wird die Wirkung dieses kleinen Buchladens jederzeit gerne bestätigen. Diese Wirkung beginnt bei den Räumlichkeiten, die ihren ganz eigenen Charme haben, und wird über die fleißigen Mitarbeiter (sic!) bis zu den regelmäßigen Besuchern des kleinen Ladens und den daraus entstehenden Grüppchen weitergegeben. Der Verfasser des folgenden Artikels heißt Dirk. Er lebt in Berlin und ist leider eher selten im Laden anzutreffen. Jedoch gehört er zu einem der oben angesprochenen Grüppchen und ist im Forum regelmäßig unter dem Namen Night Crawler aktiv. Ein passender Beitrag für einen Laden, der sich der phantastischen Literatur in all ihren Ausführungen verschrieben hat. Widmet er sich doch J. R. R. Tolkien, der in vielerlei Hinsicht als Vater der Fantasy zu sehen ist. Ein mehr als passender Beitrag also. Und ein schönes Beispiel für die Wirkung unserer kleinen Romanboutique. Vielen Dank an Dirk und alle Lesern viel Spaß bei der Lektüre des Artikels!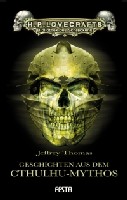
 Über H. P. Lovecrafts Werk ging es an dieser Stelle zuletzt öfter. In den letzten Wochen hat Gerd – vereinfacht ausgedrückt – über die
Über H. P. Lovecrafts Werk ging es an dieser Stelle zuletzt öfter. In den letzten Wochen hat Gerd – vereinfacht ausgedrückt – über die  Clark Ashton Smith – Werkausgabe
Clark Ashton Smith – Werkausgabe Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937) ist der Vater der modernen Horrorliteratur. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil liegt das am Cthulhu-Mythos. Auf diesen Mythos wollen wir an dieser Stelle einen oberflächlichen Blick werfen. Anlass hierfür ist die kürzlich beim Festa Verlag erschienene erste Ausgabe der zweibändigen Reihe „Chronik des Cthulhu-Mythos“ die erstmals alle Geschichten Lovecrafts zu diesem Erzählkosmos in einer Edition vereint (ein zweiter Anlass ist die Aufforderung des geschätzten Herrn Pohl, ein wenig über Lovecrafts Epigonen zu erzählen). Ergänzt wird das ganze durch ein Vorwort und Einleitungen zu jeder Geschichte von Dr. Marco Frenschkowski (1960). Frenschkowski ist evangelischer Theologe und Religionswissenschaflter. Er gilt als der führende Experte für H. P. Lovecraft in Deutschland und ist in der Phantastikszene kein Unbekannter. Erzählungen und Gedichte Frenschkowskis wurden z. B. unter dem Pseudonym Alexander Sethonius veröffentlicht. Zudem war er gemeinsam mit seiner Frau Helena der Herausgeber des Magazins „Das schwarze Geheimnis“ deren letzten beiden Bände seinerzeit in Frank Festas „Edition Metzengerstein“ erschienen sind. Gewissermaßen ein Vorgänger von Festas eigener „Omen“-Reihe deren dritter Band vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde (mit einem Beitrag unseres Local Heroes Christian Endres). Die in „Chronik des Cthulhu-Mythos“ verwendeten Texte sind ursprünglich für die Werkausgabe der Edition Phantasia verfasst worden. Für die vorliegende Edition wurden sie überarbeitet und „zum Teil erheblich verbessert“ (sic!).
Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937) ist der Vater der modernen Horrorliteratur. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil liegt das am Cthulhu-Mythos. Auf diesen Mythos wollen wir an dieser Stelle einen oberflächlichen Blick werfen. Anlass hierfür ist die kürzlich beim Festa Verlag erschienene erste Ausgabe der zweibändigen Reihe „Chronik des Cthulhu-Mythos“ die erstmals alle Geschichten Lovecrafts zu diesem Erzählkosmos in einer Edition vereint (ein zweiter Anlass ist die Aufforderung des geschätzten Herrn Pohl, ein wenig über Lovecrafts Epigonen zu erzählen). Ergänzt wird das ganze durch ein Vorwort und Einleitungen zu jeder Geschichte von Dr. Marco Frenschkowski (1960). Frenschkowski ist evangelischer Theologe und Religionswissenschaflter. Er gilt als der führende Experte für H. P. Lovecraft in Deutschland und ist in der Phantastikszene kein Unbekannter. Erzählungen und Gedichte Frenschkowskis wurden z. B. unter dem Pseudonym Alexander Sethonius veröffentlicht. Zudem war er gemeinsam mit seiner Frau Helena der Herausgeber des Magazins „Das schwarze Geheimnis“ deren letzten beiden Bände seinerzeit in Frank Festas „Edition Metzengerstein“ erschienen sind. Gewissermaßen ein Vorgänger von Festas eigener „Omen“-Reihe deren dritter Band vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde (mit einem Beitrag unseres Local Heroes Christian Endres). Die in „Chronik des Cthulhu-Mythos“ verwendeten Texte sind ursprünglich für die Werkausgabe der Edition Phantasia verfasst worden. Für die vorliegende Edition wurden sie überarbeitet und „zum Teil erheblich verbessert“ (sic!).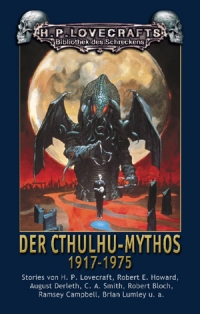 Ein anderer Teil ist wohl die Vernetzung mit den Werken anderer Autoren. Und ohne die würde heute wohl niemand wissen wer Howard Phillips Lovecraft eigentlich war. Lovecraft war ein reger Briefeschreiber und hielt so Kontakt zu vielen seiner „Mitstreiter“ wie den schon angesprochenen Robert Howard, Clark Asthon Smith (1893 – 1961) oder Fritz Leiber (1910 – 1992). Er liebte es, die Ideen dieser Autoren für seine eigenen Geschichten zu verwenden. Smiths Tsathoggua wurde sogar vor dessen eigentlichem Debüt in „Die Geschichte des Satampra Zeiros“ in Lovecrafts „Der Flüsterer im Dunkeln“ erwähnt (Smiths Geschichte wurde etwas später von „Weird Tales“ veröffentlicht). Auch auf Smiths „Buch des Eibon“ oder Howards „Die unaussprechlichen Kulte des von Junzt“ wurden von Lovecraft immer wieder erwähnt. Seinen (Brief-)Freund und Schriftstellerkollegen Robert Bloch (1917 – 1994; „Psycho“) ließ er in „The Haunter of the Dark“ sogar sterben. Eine Antwort auf Lovecrafts eigenen Tod in Blochs Geschichte „The Shambler of the Stars“.
Ein anderer Teil ist wohl die Vernetzung mit den Werken anderer Autoren. Und ohne die würde heute wohl niemand wissen wer Howard Phillips Lovecraft eigentlich war. Lovecraft war ein reger Briefeschreiber und hielt so Kontakt zu vielen seiner „Mitstreiter“ wie den schon angesprochenen Robert Howard, Clark Asthon Smith (1893 – 1961) oder Fritz Leiber (1910 – 1992). Er liebte es, die Ideen dieser Autoren für seine eigenen Geschichten zu verwenden. Smiths Tsathoggua wurde sogar vor dessen eigentlichem Debüt in „Die Geschichte des Satampra Zeiros“ in Lovecrafts „Der Flüsterer im Dunkeln“ erwähnt (Smiths Geschichte wurde etwas später von „Weird Tales“ veröffentlicht). Auch auf Smiths „Buch des Eibon“ oder Howards „Die unaussprechlichen Kulte des von Junzt“ wurden von Lovecraft immer wieder erwähnt. Seinen (Brief-)Freund und Schriftstellerkollegen Robert Bloch (1917 – 1994; „Psycho“) ließ er in „The Haunter of the Dark“ sogar sterben. Eine Antwort auf Lovecrafts eigenen Tod in Blochs Geschichte „The Shambler of the Stars“.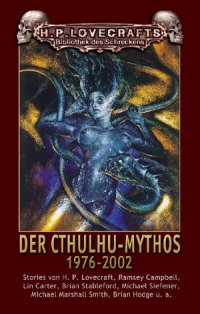 Dieses Spiel mit den Querverweisen durchzieht den Cthulhu-Mythos bis heute. Ein gutes Beispiel wäre die oben angesprochene Sammlung „Der Cthulhu-Mythos: 1917 – 1975“ und deren Fortsetzung „Der Cthulhu-Mythos: 1976 – 2002“ die beide seit einiger Zeit wieder lieferbar sind. Besonders die Beiträge der deutschsprachigen Autoren aus dem zweiten Band (Malte S. Sembten, Michael Siefener und Christian von Aster) müssen hier hervorgehoben werden, da sie sich von ihren britischen und amerikanischen Kollegen oft erfrischend unterscheiden. Da wir ohnehin bei deutschsprachigen Autoren sind, sei auch ein Hinweis auf die äußerst lesenswerte Sammlung „Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes“ erlaubt. Nicht nur findet hier der Titel einer Lovecraft-Erzählung eine Zweitverwertung. Der berühmte Detektiv aus Baker Street 221 B darf sich auch mit Erich Zanns Geige beschäftigen. Zudem muss auch Andreas Grubers „Der Judas-Schrein“ erwähnt werden. Erstmals im Rahmen von „H. P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens“ erschienen erhielt der Roman 2006 den Deutschen Phantastik Preis für das beste Debüt. Zunächst wurde der Band als Paperback nachgedruckt und bis vor kurzem war er in einer neuen Auflage innerhalb der „Bibliothek des Schreckens“ wieder als Hardcoverausgabe verfügbar. Diese ist seit kurzem vergriffen, aber das Paperback ist seit Ende November wieder lieferbar. Wer schnell ist, kann sich in der Romanboutique jedoch noch die HC-Variante sichern, die zuletzt noch im Regal stand. Gruber verbindet den Mythos mit einer dicht erzählten Kriminalgeschichte (die gelegentlich kritisierte Sache mit den Ladegeräten für die Handys ignorieren wir mal). Es ist genug wenn ich sage, dass das Ende ganz im Sinne Lovecrafts ist. Auch wenn sich der Weg dorthin vom „typischen“ Mythos-Garn erfrischend abhebt. Armer Körner, ihm hat es nichts gebracht …
Dieses Spiel mit den Querverweisen durchzieht den Cthulhu-Mythos bis heute. Ein gutes Beispiel wäre die oben angesprochene Sammlung „Der Cthulhu-Mythos: 1917 – 1975“ und deren Fortsetzung „Der Cthulhu-Mythos: 1976 – 2002“ die beide seit einiger Zeit wieder lieferbar sind. Besonders die Beiträge der deutschsprachigen Autoren aus dem zweiten Band (Malte S. Sembten, Michael Siefener und Christian von Aster) müssen hier hervorgehoben werden, da sie sich von ihren britischen und amerikanischen Kollegen oft erfrischend unterscheiden. Da wir ohnehin bei deutschsprachigen Autoren sind, sei auch ein Hinweis auf die äußerst lesenswerte Sammlung „Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes“ erlaubt. Nicht nur findet hier der Titel einer Lovecraft-Erzählung eine Zweitverwertung. Der berühmte Detektiv aus Baker Street 221 B darf sich auch mit Erich Zanns Geige beschäftigen. Zudem muss auch Andreas Grubers „Der Judas-Schrein“ erwähnt werden. Erstmals im Rahmen von „H. P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens“ erschienen erhielt der Roman 2006 den Deutschen Phantastik Preis für das beste Debüt. Zunächst wurde der Band als Paperback nachgedruckt und bis vor kurzem war er in einer neuen Auflage innerhalb der „Bibliothek des Schreckens“ wieder als Hardcoverausgabe verfügbar. Diese ist seit kurzem vergriffen, aber das Paperback ist seit Ende November wieder lieferbar. Wer schnell ist, kann sich in der Romanboutique jedoch noch die HC-Variante sichern, die zuletzt noch im Regal stand. Gruber verbindet den Mythos mit einer dicht erzählten Kriminalgeschichte (die gelegentlich kritisierte Sache mit den Ladegeräten für die Handys ignorieren wir mal). Es ist genug wenn ich sage, dass das Ende ganz im Sinne Lovecrafts ist. Auch wenn sich der Weg dorthin vom „typischen“ Mythos-Garn erfrischend abhebt. Armer Körner, ihm hat es nichts gebracht … Eddie M. Angerhuber ist kein Mann. Ich erwähne das nur, weil viele unter Euch vermutlich noch nicht von ihr gehört haben. Die 1965 in München geborene Monika Angerhuber nennt sich dem Vernehmen nach „Eddie“, weil sie ein großer Fan von Edgar Allan Poe ist. Sie gibt nur wenig von sich Preis. Nicht mal bei Wikipedia gibt es einen Eintrag über sie. Und auch auf ihrer
Eddie M. Angerhuber ist kein Mann. Ich erwähne das nur, weil viele unter Euch vermutlich noch nicht von ihr gehört haben. Die 1965 in München geborene Monika Angerhuber nennt sich dem Vernehmen nach „Eddie“, weil sie ein großer Fan von Edgar Allan Poe ist. Sie gibt nur wenig von sich Preis. Nicht mal bei Wikipedia gibt es einen Eintrag über sie. Und auch auf ihrer 


